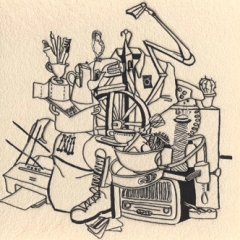Würden Sie Ihre Ausbildung und Ihren Werdegang hin zur Textilkunst beschreiben?
Ich bin Autodidaktin, kurzum, ich hatte viele Lehrerinnen. Mit 19 Jahren habe ich die Textilkünstlerin Lissy Funk in Zürich kennengelernt. Ihre Werke (riesige Wandteppich mit dreidimensionalen Strukturen) und ihre Werkstatt haben mich so sehr verzaubert, dass ich darum bat, bei ihr in die Lehre gehen zu können. Sie lehnte dies aufgrund ihres hohen Alters ab. So trampte ich alle zwei Monate von Berlin nach Zürich „zum Kaffee“ und brachte ihr neue Arbeiten von mir mit. Sie kritisierte, nahm manchmal auch eine Schere zur Hand, bis sie – nach zwei Jahren – eine Arbeit würdig befand, diese zu einem Wetbewerb einzureichen. Ich studierte in Berlin Kostümbild und besuchte auch die Kurse von Frau Prof. Erdmann in Textilkunde. Zu ihren Vorträgen über die Geschichte der Stickerei brachte ich eigenhändige Beispiele mit. In einem Projekt lernte ich die Textilrestauratorin Frau Jeitner kennen und ich befasste mich mit der besonderen Hülle eines Menschen: der Haut. Ich versuchte den taktilen Reiz über vielfältige gestickte Strukturen zu visualisieren.
Sie haben eine spezielle 3D-Technik entwickelt. Würden Sie uns davon erzählen?
Die Haut hat keine eigene Form, sie ist die wertvollste Umhüllung eines Menschen. Was erzählt die Haut über ihren Träger? Wie wird sie, wie altert sie? Die erste Serie entstand zu diesem Thema. Sie wurde zu einem Lebenslauf einer Frau über ihre Leinwand Haut. Eine besondere Eigenschaft einer Frauenhaut ist, dass sie sich um das 8-fache in der Schwangerschaft wölben kann. Die entstandenen Werke gehen von der flachen Arbeit übers Relief bis zur freistehenden plastischen Skulptur. Die Technik gleich dem eines alten Bienenstocks: über mehreren Wollfäden werden Festonstiche genäht.
Arbeiten Sie gern in Serien?
Die Oberfläche der Skulpturen löste sich immer mehr auf, in einer weiteren Serie beschäftigte ich mich mit dreidimensionalen Netzwerken. Wobei die Spielerei mit Licht und Schatten eine weitere Serie nach sich zog. Ja, ich arbeite gern in Serien. Mal ist es ein Thema (Haut) oder ein Material (Kupfer) oder eine Technik (Tuchintarsien und die transparente Variante: Branding & Stitching – mit einem Lötkolben werden aus Polyesterorganza Farbschnipsel geschnitten, übereinandergelegt und festgenäht), mit der ich mich eingehend beschäftige.
Seit einigen Jahren experimentieren Sie mit Kupferdraht, was reizt Sie an diesem Material?
Eine häufige Frage in der Ausstellung bezüglich der textilien Plastiken lautet: „Is‘ da Draht drin?“ Stolz konnte ich dies verneinen. Mich interessierten immer mehr freistehende durchsichtige Skulpturen. Da die notwendigen Abspannungen die Sicht nehmen, habe ich mich mit Kupferdraht beschäftigt. Ich dekliniere den Werkstoff durch alle mir bekannten textilen Techniken, doch steht nicht das Handwerk, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung im Vordergrund. Das Studieren der Techniken ist das Ringen um eine geeignete Formulierung, ich versuche mit meinen Arbeiten zu erzählen. Mit dem dünnen Metall kann man Knoten machen, man muss jedoch beim Arbeiten darauf achten, dass der Draht nie geknickt wird, dann bricht er. Ich habe geknüpft, gestickt, gehäkelt, geklöppelt und gestrickt. Ich fragte mich, wie fein man damit arbeiten kann und habe mit einem Metallhaar von 0,015 mm ein Jäckchen gestrickt, das der Größe eines Embryos im dritten Schwangerschaftsmonat entspricht. Insbesondere bei den Anfangsreihen wurde das Feingefühl fast überstrapaziert (eine falsche Bewegung und das Haar riss), mit jeder weiteren Reihe wurde das Gestrickte stabiler, selbst der Arbeitsprozess unterstreicht die inhaltliche Auseinandersetzung: im Heranwachsen stark werden. Anschließend habe ich die Teile zusammengenäht und in Form gebracht. Eine befreundete Gynäkologin überprüfte die Maße – die erste Untersuchung und nickte zustimmend.
Würden Sie uns kurz erklären, was Tuchintarsien sind?
Unter Tuchintarsien verbirgt sich eine sehr alte Technik mit gewalkter Wolle. Man schneidet aus zwei verschiedenfarbigen Wolltüchern die gleiche Form aus und legt sie anschließend, die Farben wechselnd, wieder ineinander (nun hat man zwei Wolltücher mit gleichen, genauer: inversen Bildern.) Die Einzelteile verbindet man unsichtbar mit einem Hexenstich, wobei man nicht durch den Stoff sticht, sondern zwischen den Lagen näht, man sieht oben nur minimal kleine Einstichlöcher. Hat man die Fadenspannung gleichmäßig geführt und vor allem sehr sauber ausgeschnitten, so ist das Bild auf einer Ebene, Vorder- und Rückseite sind gleich.
Im Museum Europäischer Kulturen hat man 10 Jahre lang über Tuchintarsien geforscht und eine große Ausstellung zusammengetragen. Das älteste Beispiel ist 500 Jahre alt. Ich bot dem Museum an, diese alte Technik in Workshops zu vermitteln und dabei einen zeitgenössischen Teppich zusammenzustellen. Die Vorbilder waren Graffittis aus Berlin, die sich hervorragend eignen, da die gesprayten Wandbilder auf ausgeschnittnenen Schablonen basieren. Ich finde es sehr poetisch, dass mit Hilfe eines uralten Handwerks die vergänglichen Kunstwerke gespeichert wurden. Sie erzählen über die modernen Ornamente unserer Straßen, wobei die meisten Bilder, die in dem Teppich festgehalten wurden, nicht mehr zu sehen sind. Während der Workshops entstanden viele gute Gespräche. Meinungen haben sich geändert, neue Sichtweisen wurden erfahren.
Wie arbeiten Sie? Würden Sie anhand eines Werks die Arbeit von der Idee zum Entwurf bis hin zur Fertigstellung beschreiben?
Vor zwei Jahren begann eine virtuelle Reise nach Grönland. In meiner Werkstatt läuft unentwegt das Radio. Es wurde vermeldet: „Erdbeeren in Grönland.“ Ich lachte. Am Abend recherchierte ich im Internet und fand den Grönländischen Gärtner. Ich beschloss, eine kleine hockende Figur zu schnitzen, auf deren Kopf eine Erdbeerpflanze wuchs. Um ihr landestypische Gesichtszüge zu geben, musste ich mir unendlich viele Inuitfrauen ansehen. Je mehr ich über das fremde Volk las, desto mehr war ich fasziniert. Ich versuchte meine Fragen, mein Staunen, meine „Erlebnisse“ mit analogen Kunstwerke anschaulich zu machen. Anfangs wähnte ich mich in einer Weltgegend, in der Textilien keine Rolle spielen. Inuit sind angezogene Menschen – wir verbinden mit ihnen sogleich die berühmte Fellkleidung. Ohne adäquate Kleidung wäre ein Leben in der Arktis unmöglich. Die Inuit trotzten der Kälte, weil sie ihre Körperwärme nutzten, die nach innen getragene Fellschicht isolierte die Körperwärme, die weitere Fellschicht verhinderte ein Auskühlen. Genäht wurde ausschließlich sehr fein mit der Hand im Überwendlingsstich oder mit wasserundurchlässigen Kappnähten. Mich beeindruckte, dass sich die Inuit der lebensbedrohenden Kälte erfolgreich erwehrt haben, durch Sorgfalt und Feinheit ihrer Handarbeit. Weitere Stichworte wirbelten durcheinander: Perlen, Kragen (Frauentracht der Inuit), Kälte, Braut (Hochzeitsankündigung der letzten Wikinger aus Grönland), Fell, hohle Haare (Eisbär), Transparenz (Eis), die Feinheit von Nähten, die Sorgfalt. Die gestalterische Antwort ist ein transparentes künstliches Fell in Form eines Kragens. Der weiße Seidentüll ist beknüpft mit weißen (hohlen) Angorahaaren (ca. 20 gr) und beschwert mit 20 gr Perlen, die ein Muster andeuten.
Die Arbeit ist dreidimensional und doch kein echtes Kleidungsstück, es ist eine poetische Dokumentation zum technischen Begriff wärmeisolierender Luftkammern. Tatsächlich spürt man – ähnlich einer Zeitung, die man eine Zeit lang auf den Knien liegen lässt – die Wärme, die dieses durchsichtige „Fell“ speichern kann. Die unfassbare Kälte indes spürte ich deutlich nicht in der Landschaft, sondern zwischen den Menschen. In der Geschichte der Inuit reihen sich viele Beispiele von Rassismus aneinander. Zum Beispiel siedelte die kanadische Regierung Inuitgruppen zwangsweise um, sie raubte ihnen nicht nur ihren Lebensraum, sondern auch ihre Namen, sie wurden künftig nur unter Nummern registriert. Junge Studenten bemühen sich heute, die Namen der Personen zu finden, die auf unzähligen Fotos abgebildet wurden. Es ist ein kleiner, aber wichtiger Baustein, aus der eurozentrischen Bevormundung auszubrechen, nicht mehr als Forschungsobjekte angesehen zu werden, sondern die eigene Identität zu ergründen. Folglich sah ich es als meine Aufgabe an, den vollständigen Namen der Inuitfrau heraus zu bekommen, deren zeitlos schönes Bild mich so sehr beeindruckt hatte, dass ich es akribisch nachstickte. Diese Recherche war so aufwändig wie die zarte Stickerei und stellt auch den Schluss dieser Serie dar.
Was inspiriert Sie?
Ich bin eine zeitgenössische Textilkünstlerin und hinter dieser anachronistischen Identität verbirgt sich meine Sprache. Mein Wortschatz und meine Grammatik bestehen aus den vielfältigen, textilen Rohstoffen und Techniken, es geht um eine Aussage über unsere Gegenwart. Ich will keinen Hit in der Warenwelt landen, sondern stimmige Lieder der wahren Welt finden. Fern ist mir der reine Dekor. Ich mag keine Oberflächlichkeiten, auch wenn ich mich virtuos mit reizvollen Strukturen beschäftigt habe. Ich erzähle mit und/oder über Textilien, denn sie sind – wenn auch ein vernachlässigtes – Speichermedium. Ich versuche unermüdlich zu lernen, zu begreifen und diesen Prozess sichtbar zu machen. Die konsumorientierte Sichtweise beim Publikum verhindert Blicktiefe, die ich immer häufiger vermisse. Es geht nicht darum, die Artistik in Sachen Handspitze vorzuführen. Dem Betrachter entgehen beim flüchtigen Blick die feinen Fäden, die einem Mund die Milde gaben. Es ist nicht die Unkenntnis, die mich betrübt, sondern die Interessenlosigkeit, die Nicht-Neugierde. Ich sehe stattdessen in überfüllte Augen, hastiges Auswerten der ersten Wirkung eines Werks. I like it or not, klick, weg. Weg damit – ohne zu speichern. Doch gerade der unzeitgemäße Aufwand, der in den Arbeiten wohnt, vermag manchmal zu irritieren und zu berühren.
Kunst ist die Einladung zur Auseinandersetzung. Ich lade ein.
Finden Sie, dass die Textilkunst die Anerkennung unter den Künsten erhält, die sie verdient?
Nein. Weil … es fängt schon bei der Ausbildung an. Handarbeit wurde geschätzt als Gradmesser von Ausdauer, Fleiß und Verschönerung von Haus und Körper. So wurde es auch gelehrt – am Produkt und nicht am Prozess orientiert. Kein Platz für Fehler oder Neuerfindungen. Es wurde gar ausgeschlossen, dass die Handarbeiterin etwas zu sagen hat. Zudem hat der Markt Textilien völlig entwertet, was im grausamen Mißverhältnis zu der Tatsache steht, dass Handarbeit vor allem Zeit braucht. Viel Zeit. Es ist nicht einfach, mit Hilfe einer Nadel die Stimme zu erheben, eine Sprache zu finden und sich Gehör zu verschaffen. Gelingt dies, reagiert der Kunstmarkt, aber seinem Wesen (ein offenes Auge auf die Welt zu werfen) zum Trotz wird in vielen Ausschreibungen die Sparte Textilkunst gar nicht erwähnt.
Due Website von Ursel Arndt ist: www.ursel-arndt.de
Alle Bilder wurden von Frau Arndt zur Verfügung gestellt.